Nach einer siebzehneinhalb-stündigen FlixBus-Fahrt kann ich sagen: Das mache ich nie wieder.
Laut Plan sollte der Bus vor Lyon nur noch in verschiedenen schweizer Städten halten. Stattdessen war es eine Zickzackfahrt über Deutschland (einmal wachte ich aus meinem Halbschlaf auf und war in der Nähe von Augsburg) und wir waren insgesamt viermal in einer Grenzkontrolle (einmal Deutschland, zweimal Schweiz, einmal Frankreich), bei der der Bus jeweils vollbeleuchtet und aufs gründlichste gefilzt wurde. Die letzten sechseinhalb Stunden war dann noch ein pausenlos schreiendes Kleinkind mit an Bord, das direkt hinter dem armen Busfahrer saß.
Es hat mich fast eineinhalb Tage gekostet, mich von der besagten Busfahrt zu erholen, daher hier ein paar kleine nicht-chronologische Impressionen und Erkenntnisse aus Lyon:
Wenn man eine furchtbare Fahrt hat, daaann bis zum Ende!
Als ich völlig zermatscht am Busterminal neben dem Bahnhof Perrache ankomme, frage ich GoogleMaps, wie ich zum Hostel komme. Dieses schlägt mir eine Fahrt von genau einer Station mit dem Fernzug vor und dann achtzehn Minuten laufen. Klingt wunderbar mit Gepäck bei wieder einmal rund 30 °C in der Mittagszeit. Eine andere Verbindung schlägt Google nicht vor.
Ich stelle mich daher beim Reisezentrum an, um sicherheitshalber nochmal nachzufragen. Die Französin zieht auf mein „Parlez vous anglais?“ die Augenbrauen hoch und guckt spitz. Ich zeige ihr auf der Karte, wo ich hin will und sie sagt „Metro“ und deutet ungenau mit dem Arm in irgendeine Richtung.
Mehr ist aus ihr nicht rauszukriegen.
Müde und k.o. beschließe ich, dass es aufs gleiche rauskommt nach einer Bahnstation achtzehn Minuten zum Hostel zu laufen oder lange nach der (richtigen) Metro zu suchen und dann auch unbestimmt viel zu laufen.
Für nur erfreuliche 1,80€ kaufe ich mir also ein Zugticket und sitze nach einigen Minuten in einem blitzblanken TGV, putzigerweise sogar mit Sitzplatzreservierung.
Da sitze ich eine Weile. Und noch eine Weile. Kurz bevor der Zug losfahren soll, kommt eine Durchsage; ich verstehe „Sac bleu“ und dass sich der Besitzer dieses einsamen Gepäckstücks bei der Bahnhofspolizei melden soll.
Fünf Minuten später wird erst der Zug, dann das ganze Gleis geräumt. Wir stehen also in der Halle und sehen von weitem, wie das Militär sich bereit macht den Zug zu durchsuchen und die blaue Tasche zu prüfen.
Es werden Sperrbänder an den Treppen angebracht und mir gegenüber setzt sich ein junger Mann mit einer Katzentransportbox. Aus dieser guckt tatsächlich eine schwarz-weiß gefleckte Katze aufgeregt in die Bahnhofshalle. Ich muss wieder mal an meine eigenen Tiger denken…
Als Minuten vergangen sind, traue ich mich eine Bahnmitarbeiterin zu fragen, wie lange das jetzt voraussichtlich dauern wird.
In der Regel zwischen fünf Minuten und zwei bis drei Stunden, kommt es in gutem Englisch zurück. Ohgott. Keine Sorge, das Militär sei schon da. Als ich ihr zeige, dass ich nur eine Station fahren will, habe ich doch noch Glück: Sie kann mir die genaue U-Bahn-Strecke samt Umstieg beschreiben, „You cannot miss it!“ Ich hoffe das stimmt und kaufe mir noch ein Ticket.
Tatsächlich komme ich damit zu dem anderen Bahnhof. Als ich dort Aussteige, merke ich, dass die vorherige Station deutlich näher am Hostel war und fahre eine Haltestelle zurück. Einen zehnminütigen Fußmarsch später bin ich end-lich im Hostel.
Fazit 1: GoogleMaps für öffentliche Verkehrsmittel funktioniert in Lyon nicht. Es kennt weder U-Bahnen noch Busse, schlägt dafür aber Fernzüge und halbstündige E-Scooter-Fahrten vor.
Fazit 2: Die älteren Bahnmitarbeiter in Frankreich können so gut englisch wie die Deutschen.
***
Hostel!
Das Hostel habe ich mir ausgesucht nach den Kriterien Preis, allgemeine Online-Bewertung, Bewertung hinsichtlich Geselligkeit und Klimaanlage.
Ich lerne später, dass es erst vor zwei Jahren von einem Vielreisenden gegründet wurde, auf Nachhaltigkeit setzt (man versucht hier Müll zu trennen und Kompost zu sammeln (keinen Reis dort rein!!!!) und dabei auch sozial engagiert ist: Jugendliche mit schwierigem Hintergrund können hier wohl über längere Zeit bleiben und sich in „normaler Umgebung“ aufhalten. Das erklärt die drei bis vier Figuren, die hier täglich quasi rund um die Uhr im Aufenthaltsbereich sitzen und auf ihrem Laptop Shooter spielen oder ihre Fußsohlen begutachten.
Insgesamt ist es hier nett, jedes Bett hat einen eigenen Vorhang für Privatsphäre, der nur gelegentlich samt Stange abstürzt. Die Betten übertragen die Bewegung jedes einzelnen im Raum außerdem nach diesem Prinzip.
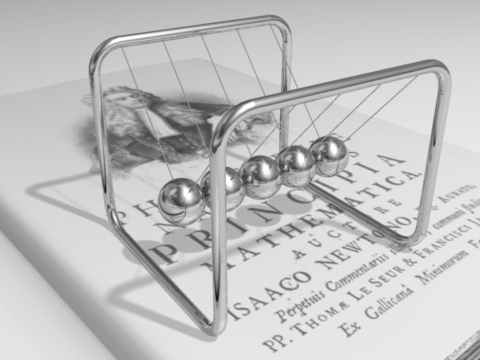
Die Küche ist ganz gut ausgestattet und es gibt die übliche Free Food Abteilung von Sachen, die andere Reisende dagelassen haben.
Fazit: Das Hostel ist nett und man kann es dort ein paar Tage aushalten, mal mit mehr, mal mit weniger gutem Schlaf.
***
Die Leute im Hostel!
Naturgemäß tummelt sich im Hostel einiges internationales Volk. Manche sind nur für normalen Urlaub dort, andere haben besondere Geschichten. Die ersten drei Tage hat es einen Hauch vom Hostel der Gestrandeten:
Ich treffe Amy aus England, Mitte zwanzig, leuchtend blaue Augen, britisch-authentisch knappe Kleidung, lieb und still, etwas schüchtern. Sie schläft im Hochbett gegenüber (und das sehr viel und lang) und arbeitet hier. Es stellt sich heraus, dass auch sie Work&Travel macht und nach einem nicht so gelungenen Aufenthalt in Paris in den Süden geflohen ist, um hier einen Job zu suchen. So ist sie eben auf das Hostel gekommen und hier ist sie schon seit über drei Wochen, da sie noch keinen neuen Job gefunden hat. Oh weia, ich hoffe ich versacke hier nicht.
Amy hat als Kunstrestaurateurin gearbeitet und wie ich gekündigt. Hier in Lyon hat sie ihre Liebe zu Frankreich entdeckt und will Französisch üben. Im Gegensatz zu mir sucht sie spezifisch heiße Regionen und orientiert sich daher nach Süden.
Im Verlauf meines Lyon-Aufenthalts findet sie tatsächlich doch endlich eine Familie in Südfrankreich, bei der sie das Haus restaurieren soll, was nach ihren eigenen Angaben wie ihr früherer Job in groß ist. Bis sie abreist, dauert es aber noch eine gute Woche, sie wird also rund fünf Wochen hier sein.
Ich treffe Alfonso aus Spanien. Er ist ebenfalls Mitte zwanzig, hager, hat halblange Haare und trägt nur schwarz, bevorzugt ein übergroßes Jacket und abgetragene schwarze Leder-Businessschuhe. Denker-Typ. Hat zuvor Philosophie studiert und jetzt etwas, das wie Filmkritik-Philosophie klingt. Er reist eine Weile ohne fixen Plan herum, will eigentlich couchsurfen, findet aber meist nur komische Männer. Ich frage nach und erfahre, dass es eine Menge Typen gibt, die spezielle Hausregeln haben, wie: Innerhalb des Haushalts laufen alle ausnahmslos nackt herum.
Alfonso arbeitet ebenfalls schon seit drei Wochen im Hostel, um herauszufinden wohin es weitergeht. Und er mag Amy.
Als nächstes ist geplant, dass er einen Freund in Nordspanien besucht und auf dessen Couch schläft.
Als der Freund mangels Zeit absagt, fällt er in ein tiefes Loch und ist zwei Tage ratlos, wie es weitergeht. „I thienk I’ll have to go hooome!“
Er guckt diverse Alternativen durch, billige Transportwege, verliert sich in Optionen.
Schlussendlich lässt der Freund ihn doch noch auf der Couch schlafen und Alfonso bucht eine Mitfahrgelegenheit dorthin. Der Fahrer ist ihm so suspekt, dass er meint er würde gekidnappt werden, trotzdem fährt er am Ende, leicht verschnupft mit Abschiedsschmerz vom Hostel und Amy, ab – und kommt, wie ich später erfahre, auch sicher an.
Alexander aus Deutschland. Er hockt im Schneidersitz auf der Arbeitsfläche zwischen Toaster und Spülbecken, als ich die Küche betrete. Anfang zwanzig, hellblonde Rasterlocken, wildgeblümtes Hemd (sein einziges, scheinbar), dünn und äußerst sprunghaft.
Er läuft den Jakobsweg. Und zwar seit neun Wochen, seit Freiburg. Er ist zu Fuß nach Lyon gekommen!
Leider ist ihm jetzt das Geld ausgegangen. Als gelernter Gärtner hält er in Lyon nach Jobs in Blumen Ausschau und zeigt mir ein Foto eines handgeschriebenen Zettels, den er abends in der Tür eines Blumenladens gesehen hat. Ich entziffere, dass es sich hierbei leider nicht, wie er glaubte, um eine Stellenausschreibung handelt, sondern eine Information: Wegen Ferien in den nächsten zwei Wochen geschlossen.
Ich erfahre noch, dass er die ganze Strecke hierher in Parks und auf Wiesen gezeltet hat, wobei sein Zelt eigentlich nur aus einem Moskitonetz besteht, den Rest habe er entsorgt. Ob es nie geregnet habe, will ich wissen. Doch, einmal habe es ein ziemliches Unwetter gegeben, da habe sich ein Ehepaar erbarmt und ihn ins Haus gelassen. Und zwischendurch habe er sich auf Zeltplätzen eingeschlichen zum Duschen.
Leider bleibt seine Jobsuche etwas zaghaft und komplett erfolglos und nach eineinhalb Tagen verkündet er nun heimreisen zu müssen. Mit einem Rucksack auf dem Rücken, der vom Volumen eigentlich nur an Schulrucksack erinnert, bricht er Richtung Bahnhof auf. Dort will er nächtigen, bevor er sich um 3 Uhr morgens in eine rund vierundzwanzigstündige FlixBus-Fährt stürzt. Der Arme.
Brindon aus New York ist sicher eine der auffälligsten Erscheinungen, die ich je getroffen habe. Androgyne Züge, ich schätze ihn Ende zwanzig, er könnte aber auch zehn Jahre jünger oder zehn älter sein. Struppelig-blonde Locken, ein an den Ärmeln abgeschnittenes und äußerst betagt wirkenden Lakers-T-Shirt, Unmengen Tattoos, die an Kugelschreiber-Skizzen erinnern und eine Harry-Potter-würdige runde Brille mit schwarzem Rahmen.
Er reist ein bisschen durch Europa, was gleichzeitig seine erste Reise außerhalb der USA sei. Ich frage nach, ob er niemals in Mexiko oder Kanada war. Ach doch, Kanada. Das sei aber das gleiche wie die USA, nur andere Währung und Politik.
Ursprünglich kommt er aus Baltimore und erzählt von der starken Teilung der Stadt zwischen Afroamerikanern und Weißen. Die Stadt lag während des Bürgerkriegs genau an der Grenze, so dass im Süden der Stadt noch Sklaverei herrschte, während es im Norden schon relative Freiheit gab.
Er gibt mir einige Reisetipps für New York. Der wichtigste: „Don‘t go to Manhattan. Manhattan sucks. It’s boring, just the touristy thing. Go to Brooklyn!“
Er hat dort zuletzt ein Jahr als Reisebegleiter gearbeitet für Klassenfahrten ins Grüne. Dabei war er teils tagelang mitten im Wald und dann wieder plötzlich in New York City. Und zum Saisonende war er dann drei Monate in New York und hatte nichts zu tun. Ich glaube ihm sofort, dass dieser Wechsel zwischen Wald und Metropole, von Vollzeitkinderdompteur zu nichts-zu-tun ziemlich heftig ist.
Wenn er in einigen Wochen fertig mit seiner Reise ist, er zeltet übrigens auch meist in Parks oder in den Bergen, orientiert er sich neu. Aber New York sollte es schon wieder sein, er liebt die Stadt!
Am nächsten Tag lerne ich seinen Landsmann RC kennen. Sieht aus wie ein Vorzeige-Kelte, mit roten langen Haaren, Sommersprossen, blaue Augen. Zuerst halte ich ihn für einen der Jungs mit schwierigem Hintergrund, da ich ihn vormittags nur auf seinen Laptop starren sehe. Er spielt dort ein Shooter-Spiel in einer mediterrane, an Venedig erinnernden Szenerie. Als ich mich abends aber mit meinen Nudeln an seinen Tisch setze, wird er ganz von selbst äußerst gesprächig: Er kommt aus Ohio, ist dreiundzwanzig, hat in New York (schon wieder) eine Ausbildung zum Koch gemacht, wegen des tyrannischen Umgangstons in den meisten Küchen aber keine Lust mehr darauf. Er mache gerne Witze und beim Arbeiten zu lachen, sei für die meistens Chefs ein Affront.
Jetzt ist er mit seinem Fahrrad nach Europa geflogen, erst quer durch Irland geradelt und nun eben durch Frankreich, dann Belgien, Deutschland, Niederlande und vielleicht noch Dänemark. Wenn er es soweit schafft, denn er würde gerne das Legoland sehen. Seine Reise sehe er wie die Geschichte bei Pokémon. Er erklärt, dass man dort von Ort zu Ort reist und Quests erfüllt, das sei auch in den meisten seiner Lieblings-Kindheitsgeschichten so. Sein Quest, höre ich heraus, ist sich zu überlegen wo und wie es weitergehen soll und idealerweise unterwegs noch die Frau seines Lebens zu treffen.
Während er noch weiter von seinen Erfahrungen als Koch spricht, fällt ihm der einzige Koch ein, unter dem die Arbeit mal wirklich Spaß gemacht hatte. Der sah aus wie die extrakleine Version eines berühmten französischen Kochs und hatte unter seiner weißen Küchenuniform Unmengen an Tattoos. RC fragt sich was aus ihm geworden ist und googlet es. Sein Lieblingskoch hat jetzt ein Restaurant in Brooklyn (schon wieder Brooklyn!). Aha! Dort werde er wieder anfangen, wenn er von seiner Reise zurückkehrt! Er bedankt sich bei mir, dass ich ihn darauf gebracht habe. Äh. Ich habe die letzte halbe Stunde hauptsächlich Nudeln gekaut. Gern geschehen! Ich freue mich für ihn, dass es dann wohl doch nett als Koch weitergeht. Nein, nein, das sei nur der Einstieg, er designe nun Videospiele! Achso.
Es gab noch viele weitere nette und interessante Leute, wie die Französin aus meinem Schlafsaal, die aktuell auf Wohnungssuche in Lyon ist (offenbar ähnlich schwierig wie in Köln) und früher für vier Jahre lang durch Asien und Australien gereist ist. Alleine darüber könnte sie vermutlich ein Buch schreiben und zeigt mir ihre „travel tattoos“. Das sind etwa 20-Cent-Münzen-große Krater an ihren Beinen: auch sie war Opfer der südostasiatischen Mücken.
Fazit: Viele sind hier auf der Suche. Und alleine für das Kennenlernen dieser Leute hat sich die Reise nach Lyon schon gelohnt.
***
Nichtsdestotrotz erzähle ich im nächsten Eintrag noch etwas über die schöne und vielseitige Stadt und meine Lieblingsorte dort.